Ausgegrenzte Eltern
 Aus dem Leben ihrer Kinder ausgegrenzte Elternteile sind betroffen von tiefer Trauer. Menschen, die beispielsweise durch Tod einen Elternteil in der letzten Lebensphase verlieren, können diesen leichter, schneller akzeptieren. Das mag daran liegen, dass es der übliche Gang jeden Lebens ist.
Aus dem Leben ihrer Kinder ausgegrenzte Elternteile sind betroffen von tiefer Trauer. Menschen, die beispielsweise durch Tod einen Elternteil in der letzten Lebensphase verlieren, können diesen leichter, schneller akzeptieren. Das mag daran liegen, dass es der übliche Gang jeden Lebens ist.
Der Verlust eines Kindes hingegen, sei es durch Tod oder Entfremdung, widerspricht dem natürlichen Lebenszyklus und wird daher als besonders heftig erlebt.
Manch einer mag bei einer Entfremdung argumentieren, das Kind sei ja gar nicht gestorben – für betroffene Elternteile und entfremdete Kinder hingegen bedeutet es dennoch Abschied zu nehmen (auf lange Zeit oder gar für immer) von einer einst liebevollen Beziehung zwischen ihnen. Ausgegrenzte Elternteile durchlaufen folgend den Prozess der Trauer.
Genau dieser Umstand, trauern zu müssen, obwohl das geliebte Kind noch lebt, ist paradox und lässt diese Mütter oder Väter in einem ungelösten Spannungszustand hilflos zurück.
Ratschläge von wohlmeinenden BeraterInnen, dem Kind ginge es doch gut, es sei schließlich nicht tot und betroffene Mütter oder Väter mögen sich den schönen Dingen des Lebens zuwenden, lösen Gefühle wie Empörung, Ärger, Scham, Verletzung und Wut aus. Betroffene vermissen hier Einfühlungsvermögen und empfinden sich in ihrem Schmerz nicht wahrgenommen.
Häufig erleben ausgegrenzte Elternteile zusätzlich Schuldzuweisungen – insbesondere durch Fachleute, Verfahrensbeistände, BeraterInnen und RichterInnen.
Hieraus resultieren intensives Leid und heftige körperliche Reaktionen, wie Magenschmerzen, Kopfschmerzen, plötzliche Herzprobleme ohne organische Ursachen, tiefe Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen bis hin zum Suizid.
Problematisch ist dabei, dass der Prozess des Trauerns (nach Elisabeth Kübler-Roß) nur selten oder gar nicht abgeschlossen werden kann, bedingt durch die paradoxe Spannungs-Situation, weil das Kind noch lebt.

Der finale Kontaktabbruch, sei es durch Umgangsvereitelung, die Folgen eines Gerichtsverfahrens (das sich für Betroffene anfühlt, wie ein falscher Film) oder die irrationale Ablehnung des Kindes, zu dem eine liebevolle Beziehung bestand, lässt betroffene Elternteile erstarren, in Hilflosigkeit versinken, im Trancezustand erleben. Die Gedanken kreisen unablässig um dieses Problem.
Die Fassungslosigkeit über die Geschehnisse lösen zunächst Gefühle von Ohnmacht und Scham aus – so ist es häufig stigmatisierend.
Die Dauer der akuten Entfremdungsphase ist hierbei bedeutend. Ist sie von kurzer Dauer, kann eine weitere Verarbeitung schneller und besser erfolgen. Zieht sie sich indes über Jahre hin, bleiben die betroffenen Mütter oder Väter in dieser Phase gefangen – das Trauma kann nicht verarbeitet werden, was erhebliche gesundheitliche und soziale Folgen nach sich ziehen kann.
Beratende trauen sich häufig nicht, die volle Wahrheit anzusprechen, um der eigenen Betroffenheit auszuweichen und trösten etwa mit „das Kind käme schon irgendwann zurück“. Offenheit und das Bewusstsein über diese zerstörte Beziehung und passende Unterstützungsangebote wären hier hilfreich, damit die Verarbeitung beginnen kann.
Ist der Kontaktabbruch vollzogen keimt bei den betroffenen Elternteilen Empörung und Wut auf. In dieser Phase der Verzweiflung ziehen sich Betroffene zurück und stehen den Beteiligten an diesem Prozess sehr kritisch gegenüber. Die hier entstehende Aggression und Verzweiflung münden in den meisten Fällen in eine Depression.
In der überwiegenden Zahl der Fälle, sind etliche Kritikpunkte durchaus berechtigt, insbesondere weil der Prozess der Entfremdung häufig nicht als solcher verstanden wird und daher auch reelle Interventionsmöglichkeiten gar nicht erst in Betracht gezogen wurden. Im Gegenteil – sie erleben oft, dass ihnen die Schuld am Tod der Eltern-Kind-Beziehung gegeben wird (sicherlich häufig aus Hilflosigkeit). Dieser Umstand ist für Betroffene extrem belastend. Auf die quälenden Fragen gibt es keine Antworten.
Angesichts fehlendem Austausch und nicht vorhandener passender Hilfsangebote, kann diese Phase nicht oder nur sehr schwer abgeschlossen werden.
Sofern Betroffene es schaffen den Prozess der Trauer bis zu diesem Punkt zu durchlaufen und ihn buchstäblich bis hierhin überlebt haben, kommen Fragen und Schuldgefühle auf über mögliche zurückliegende Versäumnisse. Hier besteht die Gefahr, dass Betroffene in diesen Gefühlen stecken bleiben, wodurch eine Verstärkung einer bereits somatischen Erkrankung oder einer Depression die Folge sein kann. Eine gefährliche Abwärtsspirale kommt in Gang.
Der innige und durchaus berechtigte, reelle Wunsch nach einer Chance mit dem geliebten Kind in Verbindung zu bleiben ist stark.
An dieser Stelle wäre es hilfreich, Gerichte würden die Auskunftspflicht des ausgrenzenden Elternteils durchsetzen. Nicht zuletzt liegt hierin tatsächlich eine Chance und kann die Basis für AKTIVES WARTEN sein, sowie die Verarbeitung unterstützen – von Scham und Schuld entlasten.
Hier braucht es adäquate Hilfsangebote und Unterstützung. Wenige Betroffene schaffen es mithilfe von Therapie und individueller Entwicklung die Depression etwas abzufedern. Viele ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück und es besteht vermehrt Suizidgefahr.
Eine Eltern-Kind-Entfremdung ist ein sehr schmerzhafter und lange anhaltender Prozess, der in der Regel mindestens Monate und meist jedoch über Jahre andauert und schließlich im Kontaktabbruch zwischen Kind und Elternteil mündet. Hieran schließt sich sehr häufig noch der scheinbar tiefe Hasse und die Verachtung des Kindes für den ausgegrenzten Elternteil. Hinzu kommen in dieser Phase noch häufig extrem belastende Gerichtsverfahren und/oder Beratungstermine.
Die Summe dieser Ereignisse löst beim entfremdeten Elternteil eine Depression individuell unterschiedlicher Intensität aus – wahrscheinlich auch bei den betroffenen Kindern.
Faktoren, die eine Depression begünstigen, insbesondere wenn mehrere der folgenden zusammen kommen und/oder einzelne Faktoren untereinander in Bezug stehen:
- biologische Faktoren:
Vorerkrankungen, genetische Faktoren, Traumata (wie schnell springt das Stresssystem an?) - psychische Faktoren:
katastrophisierende Gedanken, schwarz/weiß-Denken, Ängste, Glaubenssätze, soziale Kompetenzen, Selbstwert - soziale Faktoren:
Stressfaktoren von außen und schwerwiegende Lebensereignisse (Eltern-Kind-Entfremdung, Gerichtstermine, belastende Beratungen), ungünstige Verhaltensweisen z.B. hinsichtlich Ernährung, Bewegung, Sucht, chronische Belastungen, persönliches soziales Netz
In dieser Zeit bekommen ausgegrenzte Elternteile häufig Ratschläge sie mögen gut für sich sorgen. Das ist in der Tat sehr wichtig nur werden sich Betroffene fragen, wie sie das angesichts der Katastrophe bewerkstelligen können.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es hilfreich sein kann, die Auswirkungen der Katastrophe auf das eigene Leben in ihren Details zu beleuchten, um aus diesem Wissen individuelle Strategien entwickeln zu können für sich sorgen zu können. Aus diesem Grund gibt es hier Basisinformationen zur Depression.
Anzeichen – Symptome einer Depression
Können folgende sein, wenn mehrere Faktoren über einen längeren Zeitraum auftreten:
- Müdigkeit, Schwäche ohne ersichtlichen Grund
- Antriebslosigkeit, Niedergeschlagenheit
- Angst und Weinen
- Grübeln und Schlaflosigkeit, innere Unruhe
- Konzentrationsschwäche, Vernachlässigung von Alltagspflichten
- Rückzug von sozialen Kontakten, Fehlen von Freude
- Gereiztheit
- Schuldgefühle, Selbstabwertung
- Entscheidungsschwierigkeiten
Gut ist es, diese Anzeichen rechtzeitig zu erkennen und/oder vielleicht auch Ereignisse, die sie begünstigen, wie beispielsweise Geburtstage der entfremdeten Kinder oder Weihnachten. Sind die Auslöser wie besondere Tage oder auch individuelle Anzeichen bewusst, so besteht die Möglichkeit frühzeitig Strategien zu entwickeln und anzuwenden.
Es gibt vier Ansatzmöglichkeiten/Ebenen eine Depression oder eine besonders schwierige Phase zu bewältigen:

1. KÖRPER:
- Bewegung
körperliche Betätigung schüttet Dopamine (Glücksbotenstoffe) aus und unterstützt beim Stressabbau. Gibt es Sportarten oder körperliche Aktivitäten, die in der Vergangenheit viel Freude bereitet haben? - Ernährung
Besonders gesundes Essen unterstützt das seelische Wohlbefinden. Welche gesunden Lieblingsgerichte gab es schon lange nicht mehr? - Entspannung und Schlaf
Bewegung und Rituale zur Entspannung wie Meditation, Entspannungsbad, Wellness, Schlafhygiene können helfen zu entspannen
2. VERHALTEN:
- Ziele
Sich Ziele in kleinen umsetzbaren Schritten setzen - Tagesstruktur
sich eine hilfreiche Tagesstruktur mit Ritualen aufbauen - Verabredungen
mit Freunden bewusst treffen
3. GEFÜHLE:
Negative Gefühle können destruktive Gedanken auslösen, wodurch eine Abwärtsspirale entsteht. Anders herum besteht die Möglichkeit über die negativen Gefühle zu analysieren welche Bedürfnisse gerade nicht oder nicht ausreichend gestillt sind und hier zu schauen, welche Strategien hilfreich sind.
4. GEDANKEN:
Negative Gedanken, sich selbst zu verurteilen – dem inneren Kritiker eine Bühne zu bieten, verstärkt die Depression. Sich diesen Umstand bewusst zu machen und den inneren Kritiker zu zähmen, könnte daher eine lohnende Strategie sein.
Auch wenn Mütter oder Väter es geschafft haben sollten, den äußerst schmerzhaften und belastenden Weg der Trauerarbeit bis hier hin gegangen zu sein, so gilt an dieser Stelle, mehr denn je, sprichwörtlich „die Hoffnung stirbt zuletzt“. Hier ist die Angst vor der völligen Zerstörung der Eltern-Kind-Beziehung besonders stark und begründet. Werden Rahmenbedingungen geschaffen, beispielsweise durch Umsetzung und Absicherung der Auskunftspflichten, so kann AKTIVES WARTEN betrieben werden. Diese Option ist überaus wichtig und hilfreich, da sie Licht in die Hoffnungslosigkeit bringt und Möglichkeiten bietet, die tatsächliche existenzielle Angst überwinden zu können.
In einem „normalen“ Trauerprozess können Mütter und Väter den Tod des geliebten Kindes irgendwann akzeptieren und das Weiterleben ohne das Kind kann neu gestaltet werden.
Diese Phase der Akzeptanz können entfremdete Elternteile schlicht niemals erreichen, weil das Kind tatsächlich nicht gestorben ist. Die Hoffnung, das Kind könnte zurückkommen, die Beziehung könnte eine neue Chance bekommen, bleibt immer bestehen und damit auch der Zustand der paradoxen Spannung. Der Heilungsprozess kann daher nicht erreicht werden.
Unsere Bitten an Verfahrensbeteiligte und Beratende
-
Wir wünschen uns die Einrichtung und Unterstützung von Hilfsangeboten von Betroffenen für Betroffene.
Menschen, die kein derartiges Verlusterlebnis hatten, wird es nicht möglich sein, Betroffene zu verstehen und adäquat zu unterstützen. Wer es selbst nicht erlebt hat, tut gut daran, keinen Anspruch zu erheben, eine führende Rolle im Trauerprozess einnehmen zu können. -
Bitte versuchen Sie nicht Betroffenen den Eindruck zu vermitteln, Sie könnten sich vorstellen oder gar nachempfinden, wie sie sich fühlen oder wie es ihnen geht. Diese Art Mitleid schafft Leid, wodurch sich Betroffene eher weiter zurückziehen. Echte Empathie hingegen ist hilfreich.
-
Der notwendige Prozess der Trauer ist individuell und kann nicht beschleunigt oder verändert werden. Folgende Fragen bitten wir zu vermeiden: „Warum geht es Ihnen noch immer nicht besser?“ oder „Warum sind Sie so depressiv, Ihr Kind lebt ja schließlich noch?“, „Sorgen Sie mal für ein paar schöne Erlebnisse, damit Sie die Welt wieder positiv sehen können.“, da sie den Betroffenen vermitteln, ihre Gefühle seien „falsch“.
-
Empfehlungen wie: „dann bekomme einfach ein neues Kind“, sind wie Ohrfeigen – kein Mensch und schon gar kein Kind ist ersetzbar.
Ebenso Forderungen wie: „Dir geht es doch sonst gut – sei doch mal dankbar“ sind Auslöser für Gefühle wie Empörung und Ärger und signalisieren mangelnde Empathie.
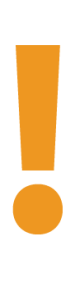
Liebe Leserin, lieber Leser
solltest Du betroffen sein von Eltern-Kind-Entfremdung und gerade sehr verzweifelt sein, bitten wir Dich ausdrücklich, Dir professionelle Hilfe zu suchen, neben dem Kontakt zu uns, denn wir können diese nicht ersetzen. Solltest Du Dich gerade in einem solchen Ausnahmezustand befinden, versuche bitte Kontakt aufzunehmen zu einer/einem Psychologin/Psychologen Deiner Wahl. Uns ist bewusst, dass es sehr schwierig ist, hier Termine zu bekommen, daher könntest Du schauen, ob vielleicht eine Klinik in Deiner Nähe eine entsprechende Notfallambulanz anbietet.